|
Fernsehbeiträge
zum Thema Hautflügler
(Wespen, Hornissen, Hummeln,
Bienen und Ameisen)
|
Natürlich
lebt diese Seite auch von Ihren Infos...
Sollten Sie einmal auf Fernsehbeiträge aufmerksam werden, die hier nicht
gelistet sind,
bedanke ich mich schon jetzt für eine Info-Mail, im Namen aller Besucher.
info@aktion-wespenschutz.de
_____________________________________________________________
Letzte Aktualisierung der Fernsehbeiträge am 19.
Januar 2026 |
Januar 2026
| Di. 06.01.26 |
17:15 - 17:50 Uhr |
 |
360º
Reportage
Peru: Stachellose Bienen, Retter des Regenwaldes
In Peru halten immer mehr
indigene Amazonas-Anwohner die tropischen Verwandten der Honigbiene. Die
stachellosen Insekten liefern nicht nur einen besonders edlen,
hochpreisigen Honig – sie sind zudem auch von zentraler Bedeutung für
die Bestäubung vieler heimischer Pflanzenarten und eröffnen so Wege der
nachhaltigen Waldnutzung. Können die Wildbienen sogar etwas zur Rettung
des Regenwaldes beitragen?
César Delgado ist der führende Experte für stachellose Bienen in Peru.
Er lebt in Iquitos und arbeitet dort für das staatliche
Forschungsinstitut des peruanischen Amazonas (IIAP). Gemeinsam mit der
Biochemikerin Rosa Vasquez Espinoza engagiert er sich in mehreren
Projekten für die Verbreitung der Imkerei mit stachellosen Bienen. So
wollen sie den indigenen Gemeinschaften Perus Wege für eine nachhaltige
und zugleich lukrative Nutzung des Regenwaldes eröffnen – und die
Bestände an heimischen Wildbienen vermehren.
Der Film begleitet die beiden Wissenschaftler auf einer Mission in das
Territorium der Asháninka, der größten indigenen Volksgruppe im
peruanischen Amazonasgebiet. Die Asháninka kennen und nutzen den Honig
stachelloser Bienen als traditionelles Heilmittel – gewinnen ihn jedoch
meist durch Einsammeln in der Wildnis oder durch die Imkerei in hohlen
Baumstämmen. Die effizientere Imkerei in Bienenkästen – so Césars
Gedanke – könnte ihnen helfen, mit dem Honig ein Einkommen zu erzielen.
Auf ihren Expeditionen suchen die Forscher stets auch nach seltenen
Bienenarten. Sie haben gehört, dass es im Gebiet der Asháninka Insekten
geben soll, die giftigen Honig herstellen. Werden sie diesen
sagenumwobenen Bienen auf die Spur kommen – und vielleicht sogar neue,
wissenschaftlich noch nicht beschriebene Arten entdecken?
|
| Do. 08.01.26
+
Fr. 09.01.26
+
So. 11.01.26 |
20:15 - 21:00 Uhr
+
09:00 - 09:45 Uhr
+
17:00 - 17:45 Uhr |
 |
Quarks: Tiere
besser verstehen
Wie die Wissenschaft ihre Sprache entschlüsselt
Ähnlich wie wir Menschen
sind auch Tiere im ständigen Austausch mit ihrer Umwelt. Vögel, Wale und
sogar Mäuse singen. Schweine grunzen und Bienen tanzen - all das, um
miteinander zu kommunizieren, zum Beispiel, um sich gegenseitig auf
Nahrungsquellen aufmerksam zu machen.
Viele der Forschungsergebnisse sind nicht nur überraschend, sondern auch
nützlich für uns Menschen. So werden Ziegen etwa als Frühwarnsysteme für
Vulkanausbrüche eingesetzt. Auch Haustiere können manchmal mehr "sagen",
als wir denken - sogar nonverbal. Hunde- und Katzenbesitzer kennen das:
Manchmal reicht ein falscher Blick, und schon gibt es Stress.
Wissenschaftler auf der ganzen Welt haben bereits Erstaunliches über die
Kommunikation von Tieren herausgefunden: Elefanten geben sich
gegenseitig Namen und Wale singen in Dialekten. Doch noch immer gibt es
Geheimnisse in der tierischen Sprache, die Forscher heute mithilfe von
Künstlicher Intelligenz zu entschlüsseln versuchen. Diese Technologie
eröffnet neue Möglichkeiten, da sie es erlaubt, Muster in der
Kommunikation viel schneller zu erkennen und sie so manchmal sogar zu
entschlüsseln.
|
| So. 11.01.26
+
Mo. 12.01.26 |
17:15 - 18:00 Uhr
+
11:10 - 11:55 Uhr |
 |
Erlebnis
Erde: Feuer, Fluten, Wirbelstürme - Überlebenstrick der Tiere
Dokumentation
Wie überleben Tiere und
Pflanzen Naturkatastrophen wie Wirbelstürme, Feuer, Erdbeben? Einige
spüren, was kommt, und können rechtzeitig fliehen. Andere müssen bleiben
und zusehen, wie sie zurechtkommen.
Viele Erzählungen von Naturvölkern handeln davon, wie geschickt die
Natur mit solchen Situationen umgeht. Jetzt beginnen sich auch
Wissenschaftler dafür zu interessieren, wie Tiere und Pflanzen auf die
Launen des Planeten reagieren, welch faszinierende Überlebensstrategien
sie entwickeln und wie es manchen sogar gelingt, von der Katastrophe zu
profitieren.
So etwa ein seltsamer Vogel auf Neubritannien in Papua-Neuguinea. Immer
wieder wird die Insel von heftigen Ausbrüchen des Vulkans Tavurvur
erschüttert. Nicht gerade das, was man sich als ideale Kinderstube
vorstellt. Und doch hat ein Grußfußhuhn genau diese, von Menschen
verlassenen Gebiete ausgesucht, um hier für Nachwuchs zu sorgen.
Normalerweise bedecken diese Vögel ihr Gelege mit verrottenden Pflanzen,
um die Hitze, die bei der Zersetzung entsteht, zum Ausbrüten zu nutzen.
Auf Neubritannien graben die Großfußhühner ihr Ei einfach in die heiße
Vulkanasche und überlassen ihr alles Weitere. Das geschlüpfte Küken muss
sich allerdings selbst den Weg ins Freie graben und ist auch danach ganz
auf sich allein gestellt.
Möglicherweise haben Schwarzmilane schon vor dem Menschen gelernt, Feuer
zu entfachen. Von australischen Ureinwohnern überlieferte Erzählungen
berichten von "Feuervögeln", die sich brennende Stöcke schnappen und
anderswo wieder fallen lassen. Sie profitieren von den Bränden, weil sie
dann leicht in Panik fliehende Kleintiere erbeuten können.
Manche Lebewesen brauchen sogar Katastrophen, um zu überleben. Einige
Eukalyptusbäume können sich nur verbreiten, wenn glühende Hitze die
Schalen ihrer Samen knackt. Und selbst wenn der Brand ihre Blätter und
Stämme verkohlt, sprießen ihnen rasch überall neue Triebe aus
Astachseln, so dass der Baum mithilfe der neuen Blätter eine
Überlebenschance hat.
Die Antilleninsel Puerto Rico liegt direkt in der Schneise
heftiger Wirbelstürme, die vom Atlantik über die Karibik ziehen. Treffen
sie auf Land, entladen sich in kurzer Zeit heftige Regenmengen. Die
Wassermassen reißen alles mit, was sich ihnen in den Weg stellt - und
zerstören auch die Nester von Feuerameisen. Die retten sich, in dem sie
im wahrsten Wortsinn zusammenhalten. Sie verhaken ihre Füße ineinander
und bilden so ein lebendes Floß. Ihre Königin und ihre Brut nehmen sie
in die geschützte Mitte. So können sie wochenlang auf dem Wasser
treiben, bis sie irgendwo anlanden und sich ein neues Nest bauen können.
Die Beispiele zeigen, wie es das Leben auf unserer Erde immer wieder
schafft, mit Naturkatastrophen umzugehen und manchmal sogar aus der Not
eine Tugend zu machen. Doch wie lange noch? Wie wird die Natur damit
fertig, dass im Zeitalter des Klimawandels Katastrophen wie Feuer,
Fluten und Wirbelstürme immer häufiger werden? Wir Menschen werden den
von uns ausgelösten Wandel vielleicht abschwächen, aber kaum mehr
verhindern können. Unser Überleben wird davon abhängen, ob wir mit der
Anpassungsfähigkeit vieler Tiere und Pflanzen mithalten können.
Inspirierende Vorbilder, dies zeigt dieser Film, gibt es genug.
|
| So. 11.01.26 |
17:15 - 18:00 Uhr |
 |
Erlebnis
Erde: Der Sturm - Tiere bei Blitz und Donner
Dokumentation
Was machen die Wildtiere
eigentlich, wenn ein schweres Sommergewitter hereinbricht, mit
Sturmböen, Blitzen, Hagel und sintflutartigen Regenfällen? Wetterextreme
wie diese kommen wegen des Klimawandels auch in Mitteleuropa immer öfter
vor. Das stellt nicht nur uns Menschen, sondern auch Pflanzen und Tiere
vor ganz schöne Herausforderungen. Der Film zeigt, wie ein Sturm
verläuft und begleitet Insekten, Störche, Waschbären und Maulwürfe bei
ihrem Überlebenskampf. Der Film zeigt, wie Tiere und Pflanzen auf die
ersten Anzeichen von Unwetter reagieren, mit welch überraschenden
Strategien sie das Unwetter meistern und wer von der vermeintlichen
Naturkatastrophe sogar profitieren kann. Dazu gibt es atemberaubende
Aufnahmen.
Der Film startet an einem richtig heißen Sommertag, mitten in Europa.
Nach einer langen Dürreperiode sind Seen und sogar Flüsse fast bis zum
Grund ausgetrocknet. Während die
Honigbienen
umherschwirren, um die letzten Wassertropfen in der staubigen Landschaft
zu finden, verbrennt eine Nacktschnecke auf dem kochend heißen Asphalt.
Gegen die Hitze hilft nur eins: Wasser. Der Himmel zeigt sich mit einem
ersten Anflug von Erlösung in Form von Wolken. Zunächst sind es
Schäfchenwolken, die sich schnell wieder auflösen, aber sie kündigen
einen Wetterwechsel an. Die darauffolgende Quellbewölkung lässt darauf
schließen, dass es wohl mehr als nur etwas Regen geben wird.
Wenn der Donner grollt und sich Blitze mit 100.000 Ampere entladen, sind
Wildtiere im Wald, auf Wiesen und Feldern einer Naturkatastrophe
ausgesetzt. Während sich Waschbären in Baumhöhlen in Sicherheit bringen
können, haben viele andere Arten keine geeigneten Strategien, um sich
gegen Regen, Wind oder Blitzeinschläge zu wappnen. Umso überraschender
ist, dass es auch Lebewesen gibt, von denen man es kaum erwartet hätte:
Manche Pflanzen schließen schon vor dem Regen ihre Blüten. Andere
Pflanzen nutzen den aufkommenden Wind, um ihre Pollen massenhaft zu
verteilen. Singdrosseln spannen mit ihren Flügeln einen Schirm auf,
damit ihre Jungen nicht nass werden und erfrieren. Doch auch Tiere, die
nicht vorbereitet sind, sind vor Gewittern nicht gefeit. Der Film
begleitet einen erst wenige Wochen alten Waschbär, der seine Familie
verloren hat und sich ohne jede Erfahrung allein durchschlagen muss.
Im Laufe des Sturms wird deutlich, dass sich verschiedene Lebensräume
neu ordnen: Für die Wildschweine sind Regen und Überflutungen ein echtes
Geschenk. Sobald es anfängt zu regnen, kommen Regenwürmer und Larven an
die Oberfläche, weil sie sonst unter der Erde ertrinken würden. Oben
wartet ein ganzer Trupp von Nutznießern auf sie: Schweine, Störche,
Erdkröten und Waschbären. So zeigt sich am Ende, dass ein Gewitter einen
natürlichen Kreislauf in Schwung bringt, der in regelmäßigen Abständen
alles und jeden auf die Probe stellt. Das ist aber nur der Fall, solange
solche Wetterextreme nicht zur Regel werden.
In diesem Film werden die Zuschauer buchstäblich mitten in einen Sturm
geführt. Und er zeigt, welche Warnzeichen in der Natur und am Himmel
auftauchen, bevor es richtig dramatisch wird. Diese Dokumentation ist
ein Mix aus Tierfilm und Katastrophenthriller. Er zeigt Verhalten von
Tieren, das man so noch nie gesehen hat.
|
| So. 11.01.26 |
22:15 - 23:15 Uhr |
 |
Planet
Weltweit
Slowenien, Land des Honigs
Imker wie der Erik Luznar
bauen auf Sloweniens gutem Ruf als Honignation auf. Er will jedoch die
traditionellen Pfade des Hobbyimkerns verlassen und mit Bienen und Honig
auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Doch ausgerechnet dieses Jahr
beginnt kalt und regnerisch. Eine Katastrophe für den Jungimker. GEO
Reportage hat ihn besucht.
|
| Sa. 17.01.26 |
07:35 - 08:30 Uhr |
 |
GEO Reportage
Slowenien, Land des Honigs
Seit Jahrhunderten ist
Slowenien ein Land der Bienenzucht. Die vielfältigen Landschaften bieten
einen reichen Pflanzenbestand, der für ausreichend Nektar und Honig von
höchster Qualität sorgt. Besonders stolz sind die slowenischen Imker auf
die Krainer Biene, die als einheimische Art ein bedeutendes Kulturgut
darstellt. Mit großem Engagement setzen sich die Imker für ihren Erhalt
ein. Tradition und Folklore prägen die slowenische Imkerei, für die
meisten Züchter steht sie nicht im Zeichen des kommerziellen Gewerbes.
Doch eine neue Generation denkt um. Einer von ihnen ist Erik Luznar, der
als Vollerwerbsimker durchstarten möchte. Von seinem Vater Janez hat er
300 Bienenvölker übernommen und führt damit die Familienimkerei bereits
in der vierten Generation weiter. Die Luznars, die in der Region
Oberkrain beheimatet sind, stellen seit Jahrzehnten Honig her.
Nach einigen erfolgreichen Jahren wird diese Saison jedoch zu einer
echten Herausforderung: Kalte, regnerische Wochen setzen den Bienen zu,
viele Völker verhungern. Um seine Tiere und das Geschäft zu retten, wagt
Erik einen riskanten Schritt: Er zieht mit einem Teil der Völker an
andere Orte, wo die Bienen neuen Pollen finden sollen. Doch die
Konkurrenz um geeignete Plätze ist groß, und auch die Artenreinheit der
Krainer Biene wird zunehmend bedroht – durch benachbarte italienische
Bienen. Hinzu kommt eine weitere Gefahr: Immer häufiger machen Bären den
Imkern das Leben schwer.
Kann Erik all diese Herausforderungen meistern und seine Imkerei auch in
dieser Saison erfolgreich weiterführen?
|
| Di. 20.01.26 |
06:00 - 06:55 Uhr |
 |
360º
Reportage
Paris, Hauptstadt der Bienen
In Paris fällt es den
fleißigen Insekten leicht, Nahrung zu finden, auch dank der über das
ganze Jahr verteilten Blütezeiten. Die abwechslungsreiche
Stadtvegetation bietet den Bienen eine Nahrungsvielfalt, die es auf dem
Land aufgrund von Monokulturen häufig nicht mehr gibt. Zudem wurde in
Paris entschieden, den Gebrauch von Pestiziden ganz einzustellen.
Selbst vom Aussterben bedroht, ist die Biene damit zum Symbol des
Erhalts der Biodiversität geworden. Eines der Habitate der Honigbienen
von Paris existiert schon seit rund 400 Jahren: der Jardin des Plantes,
ein botanischer Garten. Hier finden sich, etwas versteckt, Bienenstöcke,
die von der Gärtnerin Vanessa Voskoboïnikoff umsorgt werden. Abseits der
Öffentlichkeit wähnt man sich weit draußen auf dem Land, und doch ist
man mitten im Herzen von Paris. Ruhe ist für die Tiere auch in der Stadt
wichtig.
Die Honigbiene ist ein sogenanntes staatenbildendes Insekt. Sie kann nur
in der Gemeinschaft leben. In der Hochsaison zählt ein Bienenstock etwa
50.000 Bienen und produziert im Schnitt 30 Kilogramm Honig. Um zu
wissen, wann es Zeit ist zu ernten, überprüfen die Imker mit Hilfe eines
Refraktometers den Feuchtigkeitsgehalt.
Auch der Parc de la Villette beheimatet Bienenstöcke in einem
Schulbauernhof. Hier betreibt der junge Imker Pierre Merlet ein
engagiertes Bienenprojekt. Er gewinnt Honig und klärt nebenher
regelmäßig interessierte Gruppen über das Wohl und die Probleme der
Honigbienen auf. Pierre hat die aktuellen ökologischen Herausforderungen
im Blick. Er liebt es, sein Wissen und seine Leidenschaft mit anderen zu
teilen.
|
| Di. 20.01.26 |
11:10 - 11:55 Uhr |
 |
Erlebnis
Erde: Der wilde Norden
Das Mindener Land
Hier leben Bienenwölfe,
Biber und Bienenfresser: Das Mindener Land im Nordosten
Nordrhein-Westfalens, wo die Weser durch die Porta Westfalica bricht, zu
Füßen des Kaiser-Wilhelm-Denkmals. Dieser Landstrich ist erstaunlich
wild. Wald, Wasser und Wesermarschen formen einen abwechslungsreichen
Lebensraum, der einer Vielzahl von seltenen Tieren und Pflanzen einen
Lebensraum gibt.
Im Wilden Norden leben die meisten Weißstörche in ganz NRW. Sie ziehen
dank reicher Nahrung auf den Feuchtwiesen und konsequentem Naturschutz
ihre Jungen erfolgreich groß. Wildschweine streifen in Rotten durch die
Wälder des Wiehengebirges, Schleiereulen brüten in alten Gehöften und
gehen in den Scheunen auf Mäusejagd. In menschen-gemachten Biotopen, die
durch Sand- und Kiesabbau entstanden sind, finden Seltenheiten wieder
einen idealen Lebensraum, die genau solche Bedingungen brauchen. Und
selbst in Städten wie Minden gibt es Raritäten: In einer Kirche mitten
in der Altstadt ziehen Wanderfalken ihre Jungen auf.
Das Wesertal im Mindener Land bietet viel Platz für Tiere und bleibt
trotzdem eine Herausforderung für seine Bewohner beim täglichen Kampf
ums Überleben. Trockenheit und Hitze bedrohen das Leben von jungen Eulen
und Störchen. Staubige Sandgruben schaffen aber auch neue Lebensräume
für Spezialisten wie Bienenfresser, Gelbbauchunken und Bienenwölfe.
Sie alle haben ungewöhnliche Strategien entwickelt, um hier zu
überleben.
|
| Mi.
21.01.26 |
15:30
- 16:00 Uhr |
 |
Schnittgut.
Alles aus dem Garten
Obstbaumschnitt - Wintergehölze - Sandarium
Obstbaumschnitt
Niels Tegethof zeigt den Winterschnitt an alten und jungen Obstbäumen.
Ohne Laub lassen sich Triebe, Schäden und die gewünschte Wuchsform gut
erkennen. Überzählige Äste werden entfernt und junge Kronen gezielt
aufgebaut.
Wintergehölze
Nicole Kleb vom egapark Erfurt zeigt, welche Wirkung besondere Gehölze
im Winter entfalten. Winterschneeball und Heckenkirsche bringen frühe
Blüten, Amberbaum und Eisenholzbaum beeindrucken mit klaren Formen. Und
Mahagonikirsche sowie Zimtahorn überraschen mit eindrucksvoller Rinde.
Gartentipps:
Vorgetriebene Hyazinthen und Narzissen; Winterfütterung von Meisen,
Amseln und Eichelhähern
Sandarium
Daniel Jakumeit zeigt, wie ein Sandarium entsteht, und warum offene,
magere Böden für bedrohte bodennistende Wildbienen entscheidend sind.
Die richtige Sandmischung und wenig Bewuchs schaffen stabile Brutgänge
und fördern ihren sicheren Schlupf.
Gesunder Grünkohl
Grünkohl hat seinen Ruf als heimisches Supergemüse mehr als verdient.
Koch Thomas Sampl widmet sich der vielseitigen Winterpflanze, räumt mit
alten Mythen auf und zeigt, wie köstlich und überraschend leicht
Grünkohl sein kann.
Urban Jungle
Auch mit Zimmerpflanzen kann man sich grüne Oasen schaffen. Christopher
Beiderbeck ist umgezogen. Und mit ihm seine unzähligen Zimmerpflanzen.
Die gilt es jetzt neu zu arrangieren, Pflegetipps inklusive.
Experten geben Tipps für die Gartenpraxis und die Gestaltung von Gärten,
Terrassen und Balkonen. Einen Schwerpunkt bilden Berichte über Pflanzen
und Filme über die schönsten Gärten der Welt. Hinzu kommen viele
Anregungen und Gestaltungs-Inspirationen sowie Bastelvorschläge, Rezepte
und Wissenswertes über Ernährung, Gesundheit und Heilpflanzen.
|
| Do.
22.01.26 |
10:00
- 10:30 Uhr |
 |
|
So. 25.01.26 |
09:15 - 09:45 Uhr |
 |
Sind Wespen
Gamechanger der Evolution?
42 - Die Antwort auf fast alles -
Filmtipp
Wespen finden die meisten
von uns vor allem: unendlich nervig. Insbesondere, wenn sie uns mal
wieder den Pflaumenkuchen streitig machen wollen. Doch damit werden wir
ihnen nicht gerecht, findet der Biologe Michael Ohl vom Naturkundemuseum
Berlin. Denn Wespen spielen für das Ökosystem eine ganz entscheidende
Rolle. Sie bestäuben jede Menge Pflanzen – ja, auch Wespen tun das! Und
wären sie nicht so erfolgreiche Jägerinnen, würden wir wahrscheinlich in
Insekten versinken, vermutet er. Eigentlich müssten wir uns also beim
Anblick jeder Wespe freuen – über all die Mücken, die uns dank ihr nicht
gestochen haben.
Die Verhaltensforscherin
Seirian Sumner (Buch "Wespen,
eine Versöhnung", siehe "Link & Co." -> Literatur) findet
sogar: Wespen sind eines der spektakulärsten Tiere der Welt. Denn sie
gehören zu den ersten sozialen Wesen auf dem Planeten – und bis heute
wird beforscht, wie sie mit einem so geringen Gehirnvolumen derart
ausgefeilte Sozialstrukturen managen. Das interessiert auch Alessandro
Cini von der Universität Pisa. Er erkennt in den Wespen einen Schlüssel
zur großen Frage der Evolution: Warum Lebewesen wie die
Wespenarbeiterinnen auf ihre eigene Fortpflanzung verzichten, um die
Kinder ihrer Königin großzuziehen – obwohl sich bei der Evolution doch
alles um den Erhalt der eigenen Gene dreht.
https://www.arte.tv/de/videos/121328-012-A/sind-wespen-gamechanger-der-evolution/
|
| Mo. 26.01.26 |
08:10 - 09:10 uhr |
 |
Planet
Weltweit
Die Honigsammler von Yunnan
Schon seit Jahrtausenden
ziehen Wanderimker durch China. Sie stellen ihre Bienenkörbe immer genau
dort auf, wo die Pflanzen blühen, die einen besonders wohlschmeckenden
oder medizinisch wirksamen Honig ergeben. Der größte Teil der
chinesischen Wanderimker ist in Yunnan unterwegs, im bergigen Südwesten
Chinas. Luft, Wasser und Böden sind hier deutlich sauberer, als im Rest
des Riesenreiches.
|
| Do. 29.01.26 |
05:55 - 06:50 Uhr |
 |
360º
Reportage
Paris, Hauptstadt der Bienen
In Paris fällt es den
fleißigen Insekten leicht, Nahrung zu finden, auch dank der über das
ganze Jahr verteilten Blütezeiten. Die abwechslungsreiche
Stadtvegetation bietet den Bienen eine Nahrungsvielfalt, die es auf dem
Land aufgrund von Monokulturen häufig nicht mehr gibt. Zudem wurde in
Paris entschieden, den Gebrauch von Pestiziden ganz einzustellen.
Selbst vom Aussterben bedroht, ist die Biene damit zum Symbol des
Erhalts der Biodiversität geworden. Eines der Habitate der Honigbienen
von Paris existiert schon seit rund 400 Jahren: der Jardin des Plantes,
ein botanischer Garten. Hier finden sich, etwas versteckt, Bienenstöcke,
die von der Gärtnerin Vanessa Voskoboïnikoff umsorgt werden. Abseits der
Öffentlichkeit wähnt man sich weit draußen auf dem Land, und doch ist
man mitten im Herzen von Paris. Ruhe ist für die Tiere auch in der Stadt
wichtig.
Die Honigbiene ist ein sogenanntes staatenbildendes Insekt. Sie kann nur
in der Gemeinschaft leben. In der Hochsaison zählt ein Bienenstock etwa
50.000 Bienen und produziert im Schnitt 30 Kilogramm Honig. Um zu
wissen, wann es Zeit ist zu ernten, überprüfen die Imker mit Hilfe eines
Refraktometers den Feuchtigkeitsgehalt.
Auch der Parc de la Villette beheimatet Bienenstöcke in einem
Schulbauernhof. Hier betreibt der junge Imker Pierre Merlet ein
engagiertes Bienenprojekt. Er gewinnt Honig und klärt nebenher
regelmäßig interessierte Gruppen über das Wohl und die Probleme der
Honigbienen auf. Pierre hat die aktuellen ökologischen Herausforderungen
im Blick. Er liebt es, sein Wissen und seine Leidenschaft mit anderen zu
teilen.
|
Februar 2026
| Do. 05.02.26
+
Fr. 06.02.26 |
17:45 - 18:30 Uhr
+
03:30 - 04:10 Uhr |
 |
Unsere Erde
III
Vom Überleben in der Menschenwelt
Ein Nashorn in der City, ein
Bär in der Mülltonne und Affen im Tempel – immer mehr Wildtiere kommen
in unsere Städte. Manche sind nur auf der Durchreise, andere kommen, um
zu bleiben.
Wenn Wildtiere in unsere direkte Umgebung ziehen, haben sie in der Regel
nur zwei Möglichkeiten, zu überleben: Entweder sie tarnen sich so
perfekt, dass ihre Anwesenheit gar nicht bemerkt wird, oder sie sind so
gefährlich, dass wir Menschen Abstand halten.
Eine dritte Möglichkeit haben in Bali die Langschwanzmakaken entwickelt.
Sie gehören dort zu jedem Tempel wie in Deutschland Tauben auf den
Marktplatz. Beide Arten leben von den Abfällen des Menschen oder wurden
über lange Zeit angefüttert. Den intelligenten Makaken war es aber
offenbar zu wenig, auf die Zuwendung der Menschen zu warten.
Sie sind mittlerweile dazu übergegangen, den Touristen in den Tempeln
Dinge zu entwenden und diese gegen Nahrungsmittel wieder zurückzugeben.
Und nicht nur das: Während sich unerfahrene Diebe mit einer Banane als
Lösegeld zufriedengeben, haben die Bosse der Meute längst erkannt, wie
sie ihren Gewinn maximieren können. Einige der älteren Makaken-Männchen
haben sich auf unentbehrliches Diebesgut spezialisiert: Schuhe, Handys
und vor allem Brillen. Entsprechend dem Wert der Güter weisen die
erfahreneren Wegelagerer kleinere Tauschangebote wie Bananen empört
zurück. Längst haben sie Geschmack an Süßigkeiten und Chips gefunden.
Der Figur tut das Menschenessen nicht gerade gut, wohl aber dem Ansehen
in der Gruppe.
Den New Yorkern fallen die Ameisenkolonien in ihrer Stadt nicht
besonders auf. Tag für Tag laufen die Zweibeiner im Rhythmus der Stadt,
die niemals schläft, über den Asphalt und merken nicht, dass in den
Ritzen der Bürgersteige nicht weniger emsige Sechsbeiner auf dem Weg zur
Arbeit sind, die sogenannten Pavement Ants.
Diese Ameisen stammen, wie die meisten New Yorker, nicht ursprünglich
aus Amerika. Man nimmt an, dass sie mit frühen Siedlern auf Schiffen
anreisten. Seit ihrer Ankunft in der Neuen Welt blieben sie in der Nähe
menschlicher Siedlungen, bis sie sich schließlich zu echten Großstädtern
entwickelten. Das bedeutet vor allem, dass die kleinen Krabbler lernten,
sich mit dem Verkehr zu arrangieren und sich fast ausschließlich von
Junkfood zu ernähren. Dazu musste die Art ihr Verdauungssystem
schrittweise anpassen – heute kommt ein Ameisenmagen mit fast allen
Zusatzstoffen und Chemikalien klar, die der Mensch seinen Speisen
beimischt.
Anpassung an das Zusammenleben mit dem Menschen kann auf vielerlei Weise
geschehen. Ein erstaunliches Phänomen wird gerade in Indien erforscht.
Dort sind Schlangen ein großes Problem in den Städten. Pro Jahr sterben
60.000 Menschen an Schlangenbissen. Eine erstaunliche Ausnahme in der
Statistik ist ein Dorf in Westbengalen. Dort sind auch Monokelkobras zu
Hause, aber zu Unfällen kommt es fast nie. Das Besondere an dem Dorf
ist, dass man dort Schlangen respektiert oder sogar religiös verehrt.
Die Menschen reagieren nicht hektisch, wenn sie einen der schlängelnden
Mitbewohner sehen. Sie bewegen sich langsam und lassen dem Tier
ausreichend Zeit, sich wieder zu entfernen.
Noch erstaunlicher als das Benehmen der Menschen erscheint vielen
Forschern aber das Verhalten der Schlangen. Untersuchungen zufolge
bewegen sich die Dorfschlangen ebenfalls deutlich langsamer als ihre
Artgenossen in anderen Siedlungen und zeigen sich häufiger. Die
Überlebensstrategie der Schlange heißt dort "Gesehen werden" und
"Ausweichen" im Gegensatz zu "Verbergen" und "Angriff". Selbst wenn die
Kobras gestört werden, beißen sie dort seltener zu, sondern ziehen sich
eher zurück.
|
| Sa. 07.02.26
+
Do.12.02.26 |
16:30 - 17:15 Uhr
+
08:15 - 09:00 Uhr |

+
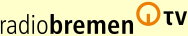 |
Quarks
Geheime Sprache der Tiere - Wie wir sie besser
verstehen können
Ähnlich wie die Menschen sind auch Tiere im ständigen Austausch mit
ihrer Umwelt.
Vögel, Wale und sogar Mäuse singen. Schweine grunzen und Bienen tanzen,
all das, um miteinander zu kommunizieren, zum Beispiel, um sich
gegenseitig auf Nahrungsquellen aufmerksam zu machen.
Viele der Forschungsergebnisse sind nicht nur überraschend, sondern auch
nützlich für den Menschen.
Die KI eröffnet der Forschung neue Möglichkeiten, da sie es erlaubt,
Muster in der Kommunikation viel schneller zu erkennen und sie so
manchmal sogar zu entschlüsseln.
So werden Ziegen etwa als Frühwarnsysteme für Vulkanausbrüche
eingesetzt. Auch Haustiere können manchmal mehr "sagen", als man denkt,
sogar nonverbal. Hunde- und Katzenbesitzer kennen das: Manchmal reicht
ein falscher Blick und schon gibt es Stress.
Wissenschaftler auf der ganzen Welt haben bereits Erstaunliches über die
Kommunikation von Tieren herausgefunden:
Elefanten geben sich gegenseitig Namen und Wale singen in Dialekten.
Doch noch immer gibt es Geheimnisse in der tierischen Sprache, die
Forscher heute mithilfe von künstlicher Intelligenz zu entschlüsseln
versuchen. Diese Technologie eröffnet neue Möglichkeiten, da sie es
erlaubt, Muster in der Kommunikation viel schneller zu erkennen und sie
so manchmal sogar zu entschlüsseln.
|
| Mi. 11.02.26 |
11:15 - 12:15 Uhr |
 |
Planet
Weltweit
Slowenien, Land des Honigs
Imker wie der Erik Luznar
bauen auf Sloweniens gutem Ruf als Honignation auf. Er will jedoch die
traditionellen Pfade des Hobbyimkerns verlassen und mit Bienen und Honig
auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Doch ausgerechnet dieses Jahr
beginnt kalt und regnerisch. Eine Katastrophe für den Jungimker. GEO
Reportage hat ihn besucht.
|
| Mo. 16.02.26 |
07:10 - 08:10 Uhr |
 |
Planet
Weltweit
Paris, Haupstadt der Bienen
Paris zieht nicht nur Menschen an, die
Stadt an der Seine ist auch für Honigbienen ein Zuhause. Etwa 2000
Bienenstöcke halten Imker heute auf den Dächern und in den Gärten der
französischen Hauptstadt.
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Filme zum Thema - Wespe, Hornisse & Co. - siehe
Link & Co. -> Filme
Mitschnitte zu Fernsehsendungen,
in denen
ich als Wespenberater und Umsiedler mitwirken durfte:
|
 |
HR -
Die Ratgeber
Wie man sich vor Wespen
schützen kann
- Umsiedlung eines Hornissennestes
Es ist Wespen-Hochsaison.
Die gelb-schwarzen Plagegeister sorgen für unbehagen. Welche Tricks gibt es
um sie zu vertreiben?
Wenn nichts mehr hilft kann ein Hornissennest auch umziehen ...
Moderation:
Daniel Johé
|
|
 |
RTL -
Stern-TV
Schutz vor Insekten-Attacken
- Das sollten Sie über Wespen wissen
Wespen sind keine gefährlichen Tiere, vor einem Stich fürchten sich die
meisten Menschen - nicht nur Allergiker.
Viele geraten durch die aufdringlichen Insekten nahezu in Panik. Dabei
lassen sich Angriffe durch Wespen durchaus vermeiden. Hier sind die Tipps
vom Wespenexperten.
Moderation: Steffen Hallaschka
|
|
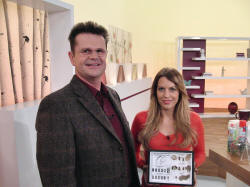 |
Hessenfernsehen -
hallo hessen
Wespenplage im Spätsommer
- Jetzt werden die Wespen richtig aggressiv
hallo hessen
ist eine 2-stündige Live-Fernsehsendung im hr-fernsehen, die täglich, außer
am Wochenende, ausgestrahlt wird.
Die Gäste sind eine bunte Mischung aus Prominenten, Künstlern und "normalen"
Menschen, die einen Bezug zu Hessen haben und etwas Besonderes tun.
Moderation: Jule Gölsdorf
|
|
 4 4 |
Hessenfernsehen -
Maintower News
Hornissenalarm
Vorsicht Jogger und Spaziergänger, im Rodgauer Wald gibt es derzeit ein
Hornissennest.
Weil
es sich zu nahe herangewagt hatte, wurde ein Ehepaar gestochen. Der Rodgauer
Wespenexperte Peter Tauchert hat den Baum, indem das Volk nistet, nun
abgesperrt. Bis
Mitte Oktober werden die Hornissen ihr Nest verlassen.
|
|
 |
ZDF.Umwelt
Keine Angst vor Wespen
Dass man Wespen am liebsten aus dem Weg geht ist
klar, aber dass sie einen schlechten Ruf haben, ist unfair. In Deutschland
gibt es einige Hundert Wespenarten. Nur acht davon leben in Schwärmen und
bauen Nester. Und nur zwei von ihnen, nämlich die Gemeine und die Deutsche
Wespe, sind Schuld am schlechten Image.
|
|
 |
Sat.1 - 17.30 Live
Hornissenumsiedelung
Die milden Temperaturen bescheren uns
zwar einen angenehmen Sommer, aber leider auch viele Wespen und Hornissen,
denn die lieben das milde Klima. Darum liegt das Wespenaufkommen in
diesem Jahr um 30 Prozent höher als zuvor. Besonders schlimm für Allergiker!
17:30 hat eine Betroffene und den Insektenberater Peter Tauchert bei seinem
Einsatz in Rodgau-Weiskirchen begleitet.
|
|

|
Hessenfernsehen -
Maintower News
Wespensaison
Die
Wespensaison hat begonnen.
Peter Tauchert hatte heute alle Hände voll zu tun. Per Wespenexperte musste
in Rodgau über 200 Wespen wegsaugen. Das Nest wurde für die Einwohner
gefährlich, da es sich direkt über der Eingangstür befand und die Wespen ihr
Revier verteidigten. Die Zeit der Großeinsätze kommt für Peter Tauchert
allerdings noch. Im September werden die Wespen besonders aggressiv.
|
|

|
Hessenfernsehen -
Maintower News.
Wespenumsiedelung vom Fachmann
Wespen lassen sich gerne einmal da nieder, wo es gar keiner braucht.
In
der Toilette von G. und K. Höfler in Offenbach zum Beispiel. Und nun... da
lassen, weg räumen... bloß nicht. Hände weg und Profis rufen...
|
|

|
Hessenfernsehen -
Service Natur
Sommer, Sonne, Wespenstich - Wespen- und Hornissenhotline
Rat und Tat bei Problemen mit Wespen und Hornissen
In solch einem Fall kann man die Wespen- und Hornissenhotline des Kreises Offenbach anrufen. Dort bieten
die Mitarbeiter zunächst telefonisch, bei Bedarf aber auch vor Ort ihre Hilfe an. Anhand der Form, Farbe und Anbringung des Nestes können sie die Wespenart bestimmen. Ein wichtiges Kriterium für das weitere Vorgehen, denn lediglich zwei der elf mitteleuropäischen Wespenarten
können dem Menschen lästig werden.
|
|
|








